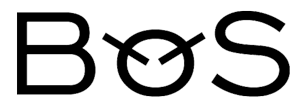Vom Verwischen der Grenzen zwischen innerem Dialog und Ich-Erzählung
Ein Interview mit Silvia Waltl
Leider kann der Workshop „Das Ich und seine Rollen“ nicht stattfinden. Trotzdem wollen wir euch einen Einblick in dieses Thema geben, das jede/n Schreibenden beschäftigt.
BÖS: Hat sich die Erzählperspektive von Texten in den vergangenen Jahren verändert? Gilt etwas als altmodisch, etwas gerade sehr ‘in’?
Silvia Waltl: Grundsätzlich ist in den letzten Jahrzehnten eine stärkere Subjektivierung des Erzählens feststellbar. Aus der Mode gekommen ist der klassische auktoriale (allwissende) Erzähler, der den literarischen Naturalismus geprägt hat und vor allem in erzählenden Langformen wie Romanen zum Einsatz gekommen ist. Heute werden viele Romane subjektiv oder multiperspektivisch, also aus wechselnden subjektiven Perspektiven erzählt. Das ermöglicht größere erzählerische Nähe und Identifikation, ein besseres Kennenlernen der Figuren, aber auch mehrerer individueller Blickwinkel, welche die Wahrnehmung verschiedener Figuren jeweils in den Fokus rücken.
BÖS: Wie weit muss man sich vom Ich lösen (können), um einen literarischen Text auf der Basis eigener Erfahrungen zu schreiben?
Silvia Waltl: Das literarische Ich ist immer ein fiktives. Jede Erzählinstanz ist ein Artefakt, also ein künstlich geschaffener Standpunkt, eine im Text installierte Position, von der aus erzählt wird. Diese kann sich in der Handlung oder außerhalb der Handlung befinden. Gleichzeitig trägt jede Figur, die wir als AutorInnen gestalten, immer auch autobiografische Züge der / des Schreibenden in sich. Es gibt keine Figurengestaltung ohne Rückgriff auf eigene Erfahrungen. Empathie ist bei der Gestaltung einer Erzählung und ihres Figurenpersonals ebenso wichtig wie im realen Leben, weil ich beim Schreiben immer nur auf das Wissen um meine eigenen Gefühle zurückgreifen kann, um emotionale und psychologische Motive oder Motive der inneren Handlung in einer Figur anlegen zu können.
Beim Schreiben kommen verschiedene Techniken der literarischen Verschlüsselung zum Einsatz. Fiktionalisierte Autobiografie oder auch: Autofiktion ist heute in der Literatur weit verbreitet. Selbst bei der Inszenierung von Figuren, die von mir als AutorIn vermeintlich weit entfernt angesiedelt sind, spielt das autobiografische Moment immer eine Rolle – und sei es, um unerwünschte, nicht ausgelebte Persönlichkeitsanteile in die Figur auszulagern.
BÖS: Was ist so schwierig daran, einen inneren Monolog zu verfassen?
Silvia Waltl: Der innere Monolog gibt vor, den / die LeserIn direkt in den Kopf der Figur hineinzuversetzen und ihr sozusagen beim Denken zusehen zu können. Bewusstseinsinhalte sollen mithilfe des inneren Monologs direkt aus der Figur heraus in Echtzeit (simultan) dargestellt werden. Der innere Monolog ist die subjektivste Form des Erzählens. Er dehnt die erzählte Zeit. Er bringt auf dramaturgischer Ebene einige Schwierigkeiten mit sich. So liegt ein Problem darin, dass Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Affekte, Erinnerungen und dergleichen in Wirklichkeit selten sprachbasiert ablaufen, sondern häufig bildhaft mit starker emotionaler Aufladung. Für den inneren Monolog müssen sie aber in Sprache übertragen werden. Das stellt automatisch eine Verfälschung dar. Als größte Hürde bei der Gestaltung innerer Monologe kann der Erzählgestus an sich gesehen werden: Der innere Monolog erzählt nicht, er bildet ab, nämlich das Innenleben der Figur. Das Verwischen der Grenzen zwischen innerem Monolog und Ich-Erzählung im Zuge des Gestaltens von Rollenprosa passiert beim Schreiben sehr häufig, da man als AutorIn dem Leser, der Leserin immer etwas von der Figur erzählen will, was aber in Form des inneren Monologs eigentlich nicht möglich ist. Fragen der Plausibilität und der Authentizität der Erzählstimme und ‑perspektive stellen sich hier also in besonderem Maße.
Foto: Burghard Unteregger